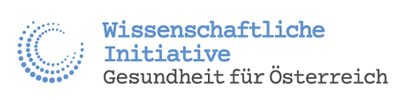In der Literatur finden sich sowohl Studien, die die Wirksamkeit von Lockdowns bestätigen, als auch solche, die sie in Frage stellen. In dieser Studie wurde einen Analyse der bisherigen Ergebnisse durchgeführt, historische Erfahrungen berücksichtigt und eine Nutzen-Risiko-Analyse basierend auf dem Zusammenhang Wohlstand und Gesundheit durchgeführt.
Die vergleichende Analyse verschiedener Länder hat gezeigt, dass die Annahme der Wirksamkeit von Lockdowns nicht durch Beweise gestützt werden kann – weder in Bezug auf die aktuelle COVID-19-Pandemie noch in Bezug auf die Spanische Grippe von 1918–1920 oder andere weniger schwere Pandemien in der Vergangenheit (keine Reduktion von Todesfällen durch restriktive Maßnahmen, sondern sogar eine Erhöhung der Gesamtmortalität).
Auch diverse Pandemiepläne nationaler und internationaler Gremien waren schon vor dem Auftreten von COVID-19 zu denselben Schlussfolgerungen gelangten – nämlich, dass Lockdowns im Falle einer Pandemie keinen klaren Nutzen bringen. Sogar in einem WHO-Dokument von Oktober 2019 wurden Lockdowns – wenn überhaupt – nur als letztes Mittel erwähnt. Alle Maßnahmen zur sozialen Distanzierung müssten laut WHO sorgfältig abgewogen werden, reisebezogene Maßnahmen oder Grenzschliessungen seien „unwahrscheinlich erfolgreich“ und Kontaktverfolgungen und Quarantäne wurde unter keinen Umständen empfohlen. Alle diese aktuellen WHO-Empfehlungen und Expertenpläne wurden jedoch gleich zu Beginn der Covid-19-Pandemie ohne ernsthafte Diskussion aufgegeben und auf Maßnahmen gesetzt, die laut vorliegenden Daten ineffektiv und kontraproduktiv waren. Die Notwendigkeit bzw. der Nutzen von Lockdowns wurde mittels empirisch nicht getesteter Modellrechnungen begründet, welche sowohl die Gefährlichkeit des Virus als auch den Nutzen der Maßnahmen systematisch überschätzten. Evidenzbasierte Nutzen-Risiko-Analysen wurden nicht durchgeführt, was den medizinischen Grundsatz „primum nihil nocere“ (vor allem nicht schaden) verletzt und vor dermaßen tiefreichenden Grundrechtseinschränkungen auch juristisch notwendig gewesen wären. Die politisch gewählte Vorgangsweise mit rigorose Unterdrückung abweichender wissenschaftlicher Meinungen legt den Verdacht auf Sonderinteressen der Entscheidungsträger nahe (Machtausweitung, finanzielle Interessen, Kontrollausweitung, Schuldenausweitung…).
Als Gründe Lockdown-bedingter erhöhter Sterblichkeit nennen die Autoren verzögerte oder unterlassene medizinische Behandlungen, vermehrter Konsum von Drogen und Alkohol, gestiegene Selbstmordraten, insgesamt ungesünderer Lebensstil, Zunahme von Gewalt, massiver psychischer und physischer Abbau vor allem bei alten Menschen durch Isolation, Pflege- und Bewegungsmangel, negative Auswirkungen von Angst, reduzierter Lebensqualität, Wohlstandsverlust und sozialem Abstieg. Es ist bereits lange bekannt, dass Gesundheit und Wohlstand eng miteinander verbunden sind und niedriges Einkommen und niedriger sozialer Status mit einer niedrigeren Lebenserwartung verbunden sind.
In der Conclusio schrieben die Autoren: „Wir schätzen, dass Lockdowns, selbst wenn sie Todesfälle durch Infektionen einigermaßen verhindern können, 20-mal mehr Lebensjahre fordern, als sie retten.“
(Anm: Strenge Nutzen-Risiko-Analysen hätten vor Verhängung restriktiver Maßnahmen durchgeführt werden müssen, um Schadwirkungen zu vermeiden. Zu Beginn der Pandemie beriefen sich viele Entscheidungsträger – trotz vorliegender Pandemiepläne – auf fehlende Daten und die Notwendigkeit schneller Entscheidungen. Spätestens beim 2. Lockdown oder auch den Schulschliessungen galten diese Argumente nicht mehr, da die erforderliche Evidenz bereits vorlag und zahlreiche Wissenschaftler vor weiteren ungezielten Maßnahmen warnten. Der empfohlene gezielte Schutz von Risikogruppen wurde dafür in vielen Ländern – auch in Österreich – vernachlässigt. So erfolgten beispielsweise die ersten verpflichtenden Mitarbeiter-Testungen im Gesundheitsbereich in Österreich erst ab November 2020 – und auch da nur bei ausreichenden Ressourcen und in Italien oder auch in New York wurden Covid-positive Patienten in Pflegeheime verlegt).