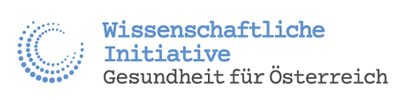Die restriktivsten nicht-pharmazeutischen Interventionen (NPIs) zur Eindämmung der COVID-19-Ausbreitung sind Ausgangssperren und Geschäftsschließungen („Lockdowns“; Anm: ein Begriff aus dem Strafvollzug). Angesichts der negativen Folgen dieser Maßnahmen ist es wichtig, ihre Auswirkungen zu bewerten.
Die Autoren analysierten anhand von 10 Ländern (England, Frankreich, Deutschland, Iran, Italien, Niederlande, Spanien, Südkorea, Schweden und USA) das Covid-19-Fallwachstum in Bezug auf die Härte der Maßnahmen. In Schweden und Südkorea gab es keine obligatorischen Ausgangssperren und Geschäftsschließungen. Die Einführung nicht-pharmazeutischer Maßnahmen allgemein führte in 9 der 10 Länder (darunter auch Schweden und Südkorea) zu einem signifikanten Rückgang der Covid-19-Fälle. Zusätzliche restriktive Maßnahmen wie Ausgangssperren und Geschäftsschliessungen zeigten jedoch keinen weiteren positiven Effekt und teilweise sogar einen Anstieg der Fälle (beispielsweise in Frankreich im Vergleich zu Schweden +7 % und im Vergleich zu Südkorea +13 %). (Anm: Damit zeigt sich, dass auch dem Argumnent „Flatten the curve“ die wissenschaftliche Evidenz fehlt. Heinz Bude, ein Soziologe und Mitglied der „Covid-19-Taskforce“ der deutschen Bundesregierung gab in einem Interview ganz offen zu, dass dieses Narrativ lediglich ein psychologisches Werkzeug war, um „Folgebereitschaft“ bei der Bevölkerung zu erzeugen. Ein Expertengremium hatte dieses Modell ausgewählt, weil es „ein bisschen wissenschaftsähnlich“ sei und daher und durch die grafische Darstellung gut geeignet war).
Die Daten zeigten eine Reduktion sozialer Kontakte und damit des Fallwachstums bereits vor Verhängung restriktiver Maßnahmen, da die Bevölkerung von sich aus auf die Bedrohungslage reagierte.
Zu den negativen Folgen von Lockdowns gehören Hunger, Verschlechterung der Gesundheitsversorgung durch verspätete oder entfallene medizinische Leistungen, häusliche Gewalt, psychische Erkrankungen und Suizidalität, verminderte Lebenserwartung als Folge von Schulschliessungen sowie eine Vielzahl wirtschaftlicher Folgen mit gesundheitlicher Auswirkungen (Anm: dazu werden reichlich Quellen angegeben). Zum Nutzen von Lockdowns gibt es eher Annahmen aus Schätzungen und Modellrechnungen (mit vielen Unsicherheiten) als empirische Daten.
Selbst wenn es durch restriktive Maßnahmen zu einer geringen Reduktion der Fallzahlen kommen würde, könnten diese Vorteile die zahlreichen Schäden dieser aggressiven Maßnahmen nicht decken.
Eine evidenzbasierte Nutzen-Risiko-Analyse restriktiver Maßnahmen ist (Anm: zumindest retrospektiv) dringend erforderlich, um Schäden in Zukunft zu vermeiden.