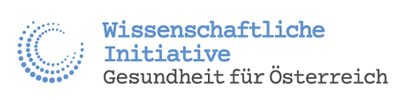(Anm: Gerade in letzter Zeit hört man immer öfter den Satz „Die Wissenschaft ist sich einig.“ Dieser Satz ist per se unwissenschaftlich.)
Der Arzt, Produzent und Autor Michael Crichton formulierte es so: „Die wissenschaftliche Arbeit hat nichts mit Konsens zu tun. Konsens ist Sache der Politik. Wissenschaft hingegen benötigt nur einen Forscher, der zufällig Recht hat, d. h., er oder sie hat Ergebnisse, die anhand der realen Welt überprüfbar sind. In der Wissenschaft ist Konsens irrelevant. Relevant sind reproduzierbare Ergebnisse. Die größten Wissenschaftler der Geschichte waren gerade deshalb großartig, weil sie mit dem Konsens brachen.“
Ist eine wissenschaftliche Theorie einmal etabliert ist es schwer ihre Fehler zu erkennen. Selbst wenn man auf eine Beobachtung stößt, die nicht zur Theorie passt, geht man davon aus, dass es eine Erklärung geben muss, die irgendwie übersehen wurde. Andersdenkende Forscher werden häufig diffamiert. Aus der Vergangenheit kennen wir genügend Beispiele über jahrzehntelangen wissenschaftlichen Konsens über fehlerhafte Thesen (z.B. zu gesundheitlichen Auswirkungen von Rauchen oder Röntgenstrahlung, zur essenziellen Rolle der Epigenetik, die lange Zeit als Pseudowissenschaft abgetan wurde…).
Häufig spielen auch sekundäre Interessen und Voreingenommenheit eine Rolle bei der Entscheidungsfindung. Dazu zählen politische Interessen wie Macht aber auch übertriebenes Vorsorgeprinzip („um auf der sicheren Seite zu sein“), wirtschaftliche Eigeninteressen (lukrative Berater- oder Vortragshonorare, Studienfinanzierung, Karriere) aber auch Konzerninteressen (Produkt-Verkauf). Voreingenommenheit ist oftmals unbewusst – so wird z.B. ein Strahlenschutzexperte die Gefahren ionisierender Strahlung anders bewerten als ein Strahlentherapeut. Finanzierung aus öffentlicher Hand ist auch nicht frei von Interessenskonflikten, da hier wieder politische Interessen eine Rolle spielen.
Ein tragfähiger wissenschaftlicher Konsens als Grundlage politischen Handelns wäre ein solcher, der auch von denjenigen mitgetragen wird, die von einer Widerlegung profitieren würden. Im Zweifelsfall sollten auch Wissenschaftler angrenzender Fachgebiete hinzugezogen werden. Vor allem bei politischen Forderungen nach mehr Regulierung oder Finanzierung sollte eine besonders kritische Prüfung erfolgen (Anm: bei Ausschluss bestimmter Meinungen aus dem wissenschaftlichen Diskurs sollten immer die Alarmglocken läuten).